Gender Pay Gap wurde in der Coronakrise kleiner – außer bei geringen Verdiensten
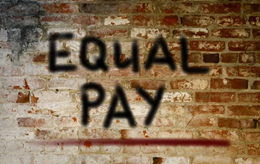
2019 lag der mittlere Gender Pay Gap, der Jahresverdienstunterschied zwischen Männern und Frauen, bei 36,2 Prozent. Die Verdienstlücke sank im Jahr 2020 um 1,2 Prozentpunkte auf 35 Prozent und 2021 auf 33,8 Prozent.
Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Dabei verringerte sich der Gender Pay Gap vor allem bei mittleren und hohen Verdiensten.
Für 80 Prozent der Beschäftigten mit mittleren und hohen Verdiensten wurde die Verdienstlücke kleiner, wohingegen sie sich für diejenigen mit sehr niedrigen Verdiensten vergrößerte.
»Die Coronakrise hat zu starken Rückgängen bei den niedrigsten Verdiensten geführt«, berichtet IAB-Forscher Alexander Patt. Dabei gingen die mittleren Verdienste der untersten 10 Prozent der Frauen deutlicher zurück als die der Männer. Von 2019 auf 2021 ließ sich hier ein Zuwachs von 3,5 Prozentpunkten auf 37,3 Prozent beim Gender Pay Gap beobachten. Dieser Anstieg betrifft neben den untersten 10 Prozent der Vollzeitverdienste auch den überwiegenden Teil der Teilzeitbeschäftigten und etwa die untere Hälfte der Verdienste in Minijobs.
Im Vergleich zu Männern weisen Frauen eine geringere Verbleibsrate in Vollzeitbeschäftigung und eine höhere Verbleibsrate in Teilzeitbeschäftigung sowie in Minijobs auf. »Der Gender Pay Gap hängt somit auch damit zusammen, dass Frauen eher als Männer in Arbeitsverhältnissen mit niedrigeren Arbeitszeiten tätig sind«, erklärt IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. »Auch verloren Beschäftigte mit sehr niedrigen Verdiensten häufiger als vor Corona ihre Anstellung. Im Fall von Minijobs konnten sie auch nicht von der Absicherung durch Kurzarbeit profitieren«, fügt Anna Houštecká, Postdoktorandin am Center for Economic Research and Graduate Education in Prag hinzu.
Die Analyse basiert auf der Stichprobe der Erwerbsbiografien aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten für Personen in der Altersgruppe 25 bis 60 Jahre im Jahr 2019. Betrachtet wurden sowohl Unterschiede in der Bezahlung als auch Veränderungen in der Beschäftigung.
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Geschlechterungleichheit in der KI-Branche: Herausforderungen und Lösungsansätze Die Randstad-Studie »Understanding Talent Scarcity: AI & Equity« offenbart eine deutliche Geschlechterkluft in der KI-Branche. In Deutschland sind 74 Prozent der Stellen, die KI-Kompetenzen …
Mehr Gründerinnen in Deutschland: Wege aus dem Gendergap Die Startup-Welt in Deutschland wird weiterhin von einem deutlichen Gendergap geprägt. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass strukturelle Barrieren und tradierte Rollenbilder Frauen daran hindern, …
Frauen stellen Mehrheit der Studierenden an deutschen Hochschulen Seit dem Wintersemester 2021/22 sind Frauen erstmals in der Mehrheit unter den Studierenden an deutschen Hochschulen. Laut einer aktuellen Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) auf Basis von Daten …
Rückgang der Verdienstungleichheit zwischen Frauen und Männern in Deutschland Die Kluft zwischen den Geschlechtern auf dem deutschen Arbeitsmarkt verringert sich langsam, aber stetig. Der Gender Gap Arbeitsmarkt, ein umfassender Indikator für Verdienstungleichheit, ist im Jahr …

