Sandra Hofhues, Julia Schütz (Hg.): PLATTFORMEN FÜR BILDUNG
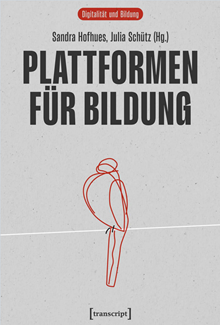
Plattformen für Bildung: Kritischer Blick auf digitale Bildungsinfrastrukturen
Digitale Plattformen als gestaltete Organisationsmodelle
Die Studie betont, dass digitale Plattformen im Bildungsbereich nicht einfach neutrale Werkzeuge sind, sondern als zentrale Organisationsmodelle des Internets Lern- und Bildungsprozesse maßgeblich strukturieren.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das »Gemacht-Sein« dieser Plattformen zu verstehen ist: Plattformen sind immer das Ergebnis technischer, sozialer und kultureller Gestaltungsprozesse. Sie verbinden technische Konstruktion mit der Imagination und Reorganisation sozialer Praktiken und beeinflussen so, wie Bildung gedacht und umgesetzt wird.
Informatische Modellbildung als analytischer Zugang
Die Autorinnen schlagen einen analytischen Zugang vor, der die Entwicklung digitaler Plattformen als Prozess der informatischen Modellbildung versteht. Dabei werden technische, formale und soziale Möglichkeitsräume miteinander verschränkt. Digitale Plattformen bestehen demnach aus drei eng miteinander verbundenen Modellen:
- einem Anwendungsmodell (Abbildung der relevanten Praxis und Prozesse),
- einem formalen Modell (Spezifikation der Operationen) und
- einem Berechnungsmodell (technische Umsetzung).
Diese Modelle sind nicht nur technische Artefakte, sondern greifen aktiv in bestehende soziale Praktiken ein und verändern sie.
Plattformisierung als gesellschaftspolitischer Prozess
Die Autorinnen heben hervor, dass Plattformisierung im Bildungsbereich immer auch gesellschaftspolitische und kulturelle Auseinandersetzungen um zukünftige Formen des Lernens und der Bildung darstellt.
Die Entwicklung von Plattformen ist nie rein technisch, sondern immer auch Ausdruck von Wertentscheidungen, Machtverhältnissen und normativen Vorstellungen über Bildung. Jede Plattform bringt bestimmte Bildungsmodelle und Steuerungslogiken mit sich und schließt andere aus.
Kritische Analyse und Leitfragen
Für die Analyse der Plattformisierung werden drei zentrale Zugänge vorgeschlagen:
- das Anwendungsmodell: Welche Annahmen über Lernprozesse und Nutzer*innen werden getroffen?
- die technischen Standards und Protokolle: Wie werden Interoperabilität und Skalierbarkeit sichergestellt?
- die etablierten operationalen Formen im Bildungskontext: Wie passen Plattformen zu bestehenden Praktiken und wo entstehen Reibungen?
Diese Leitfragen helfen, die Implikationen von Plattformen bereits in frühen Entwicklungsphasen kritisch zu reflektieren.
Ambivalenzen und Herausforderungen
Die Studie zeigt, dass auch öffentlich geförderte, gemeinwohlorientierte Plattformen nicht automatisch zu mehr Freiheit, Teilhabe oder emanzipatorischer Bildung führen. Technische Interoperabilität und offene Schnittstellen sind notwendige, aber keine hinreichenden Bedingungen für »befreiende« Plattformen. Demokratische Teilhabe, Diversität der Perspektiven und die bewusste Gestaltung von Machtverhältnissen bleiben zentrale Herausforderungen.
Visionen für die »digitale Schule der Zukunft«
Policy-Dokumente und Fachdebatten zeichnen die »digitale Schule der Zukunft« häufig als zentralisiert, vernetzt und stets einsatzbereit – mit Plattformen als Herzstück der Organisation.
Die Studie macht jedoch deutlich, dass diese Visionen auf der unsichtbaren Arbeit von Menschen beruhen, die digitale Systeme auswählen, integrieren und anpassen. Ein Spannungsverhältnis entsteht zwischen der idealisierten Vorstellung automatisierter Organisation und der realen Notwendigkeit menschlicher Organisationsarbeit.
Fazit
Die Autorinnen plädieren dafür, Prozesse der Plattformisierung im Bildungsbereich immer als gesellschaftliche und kulturelle Auseinandersetzungen zu verstehen. Sie fordern eine frühzeitige, breite und interdisziplinäre Diskussion über die informatischen Modelle und Wertentscheidungen, die Bildungsplattformen prägen. Nur so könne verhindert werden, dass technologische Lösungen bestehende Machtverhältnisse und Bildungsmodelle unreflektiert verstärken.
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Motto: Verantwortung für Deutschland Die Vorsitzenden der künftigen Koalitionsparteien CDU(CSU und SPD stellten am 9. April 2025 im Deutschen Bundestag den Vertrag vor, auf dessen Basis sie in der Legislationsperiode von 2025 bis 2029 die Bundesregierung bilden wollen. & …
Eine große Aufgabe – acht Handlungsfelder – hundert Empfehlungen für Bildungspolitik und Bildungsverwaltung, Lehrende und Lernende, Bildungswirtschaft und Zivilgesellschaft Daten aus dem Bildungsbereich könnten gezielt dazu beitragen, grundlegende Kompetenzen von Schüler*nnen …
Digitalisierung in Deutschland: Zwischen Effizienz und Bürokratie Die Unternehmen in Deutschland treiben die Digitalisierung weiter voran – aber die Hürden sind weiterhin hoch. Das zeigt die aktuelle Umfrage »Digitalisierung in Deutschland: Zwischen Effizienz und Bürokratie« …
Der D21-Digital-Index 2024/2025 ist eine repräsentative Studie der Initiative D21, durchgeführt von Kantar. Der »D21-Digital-Index« misst seit 2013 die Anpassungs- und Zukunftsfähigkeit der Digitalen Gesellschaft. Er gibt Auskunft darüber, inwiefern die Digitalisierung …

