Digitalpakt Schule: Nutzung digitaler Lehr-Lerninfrastrukturen
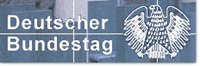
Gutes digitales Lernen kann nicht allein auf der Grundlage leistungsfähiger Lehr-Lern-Infrastrukturen erfolgen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP, die Auskunft zum Digitalpakt Schule haben möchte. Die Bundesregierung verhandelt derzeit mit den Ländern über den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des DigitalPakts Schule.
Neben die Finanzhilfen des Bundes zur Investition in die Infrastruktur müssten die Länder insbesondere die Bereiche pädagogische Konzepte und der Lehrkräftequalifizierung übernehmen. Hinzu kämen flankierende Maßnahmen, die teilweise in Kooperation von Bund und Ländern, teilweise auch in ausschließlicher Zuständigkeit der Länder ergriffen werden können. Diese Maßnahmen seien geeignet, die mittel- bis langfristige Entwicklung und effektive Nutzung digitaler Lehr-Lerninfrastrukturen in allgemeinbildenden und in beruflichen Schulen in Deutschland zu unterstützen.
Da die Zuständigkeit für den Datenschutz im Bereich Schule bei den Ländern liege, werde die Bundesregierung mit den Ländern im Bereich Datenschutzrecht zusammenarbeiten, sofern im Kontext landesweiter oder landesübergreifender Projekte im Rahmen des DigitalPakts Schule Regelungsbedarfe erkennbar würden, die Maßnahmen auf Bundesebene erfordern.
Beim Datenschutz unterstreicht die Bundesregierung, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes das Projekt "Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen" fördert. Diese wird vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt. In dem explorativen Forschungsprojekt würden Diskriminierungsrisiken durch digitale Algorithmen, Data Mining beziehungsweise Software untersucht und diesbezügliche Handlungsoptionen aufgezeigt. Die Ergebnisse würden Anfang 2019 vorliegen.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz habe für den Diskriminierungsschutz durch und bei Algorithmen das Gutachten "Technische und rechtliche Betrachtungen algorithmischer Entscheidungsverfahren. Gutachten der Fachgruppe Rechtsinformatik der Gesellschaft für Informatik im Auftrag des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen" beauftragt. Auch dazu würden die Ergebnisse Ende 2018 vorliegen.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz habe zudem 2013 eine Studie in Auftrag gegeben, die die rechtlichen Grundlagen für das Scoring nach der Novelle des Datenschutzrechts 2009 analysiert, die Scoring-Praxis empirisch untersucht und eine verbraucherschutzbezogene Evaluierung durchgeführt hat. Die Studie "Scoring nach der Datenschutz-Novelle 2009 und neue Entwicklungen" sei vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein und der GP Forschungsgruppe durchgeführt und im Jahr 2014 veröffentlicht worden. Ziel der Bundesregierung sei es, eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Nutzung von Künstlicher Intelligenz voranzubringen und dabei ethische und rechtliche Implikationen zu beleuchten. Im Projekt Assessing Big Data (ABIDA) würden bereits gesellschaftliche Folgen beim Umgang mit großen Datenmengen untersucht und unter anderem auch die Diskriminierung durch und bei Algorithmen analysiert und entsprechende Handlungsoptionen erarbeitet. Die Datenethikkommission, die ihre Arbeit im September 2018 aufgenommen habe, soll binnen eines Jahres ethische Leitlinien in Bezug auf Algorithmen-basierte Entscheidungen, KI und Daten entwickeln. Die Bundesregierung habe der Datenethikkommission Leitfragen mit auf den Weg gegeben, die sich unter anderem mit Regulierungsansätzen zur Verhinderung von Diskriminierung durch Algorithmen-basierte Entscheidungen befassen.
Die Mitglieder der Datenethikkommission arbeiteten unabhängig und würden unter Berücksichtigung der Leitfragen eigenständig Schwerpunkte setzen. Ob sich die Datenethikkommission daher auch mit dem Schutz von Schülerdaten und Lehrerdaten beschäftigen werde, sei derzeit nicht absehbar.
VERWEISE
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Künstliche Intelligenz prägt die Zukunft der Weiterbildung Der mmb-Trendmonitor 2024/2025 zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) wird zum wichtigsten Treiber im digitalen Lernen. Insbesondere »Adaptive Learning« und Chatbots gelten laut Expert*innen als erfolgversprechende …
KI-Tools als Lernbegleiter in der Prüfungszeit Mit Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen in Deutschland steigt der Druck auf Schüler*innen und Studierende. Digitale Helfer wie ChatGPT, Perplexity oder DeepL gewinnen in dieser Phase zunehmend an Bedeutung. Die IU …
Digitalpakt 2.0: Ein neuer Schritt für die digitale Bildung Am 13. Dezember 2024 haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Kultusministerkonferenz (KMK) eine Gemeinsame Erklärung zum Digitalpakt 2.0 verabschiedet. Die Erklärung gibt den politischen …
Studie verdeutlicht: Künstliche Intelligenz verbessert Lernerfolg Eine aktualisierte Studie der Internationalen Hochschule (IU) zeigt, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Lernprozess positive Auswirkungen auf die Lernergebnisse hat. Knapp 60 Prozent der …

