Neue Forschungseinrichtungen in der Bund-Länder-Förderung
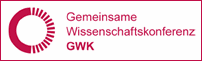
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am 7. April 2017 beschlossen, die von der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin neu gegründete Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in die gemeinsame Förderung aufzunehmen. Leiterin der Forschungsstelle wird Frau Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, bisher Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Frau Prof. Dr. Charpentier hat mit dem sogenannten CRISPR-Cas9-System einen einzigartigen Mechanismus entdeckt, der zur Gen-Editierung genutzt werden kann. Diese Technologie ist eine Revolution in der Biologie und wird bereits heute in Laboren auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Anwendungen genutzt.
Außerdem hat die GWK beschlossen, weitere zwei Einrichtungen in die gemeinsame Förderung der Leibniz-Gemeinschaft aufzunehmen: die Stiftung Institut für Werkstofftechnik Bremen (IWT) sowie das Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e.V. an der Universität Leipzig (DI). Zusammen haben diese Einrichtungen einen jährlichen Mittelbedarf von 7,2 Millionen Euro. Der Entscheidung liegen entsprechende Empfehlungen des Senats der Leibniz-Gemeinschaft und des Wissenschaftsrates zugrunde, der die Einrichtungen evaluiert hat.
Die Stiftung Institut für Werkstofftechnik Bremen (IWT) erforscht metallische Werkstoffe in einer einzigartigen Kombination von Werkstoff-, Verfahrens- und Fertigungstechnik. Die Arbeitsgebiete umfassen materialwissenschaftliche Themenfelder vom Ausgangswerkstoff über Fertigungs- und Werkstoffbehandlungsverfahren bis zu Eigenschaften metallischer und hybrider Bauteile. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung sowie den Transfer in die Praxis.
Das Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e.V. an der Universität Leipzig (DI) erforscht die jüdischen Lebenswelten vornehmlich in Mittel- und Osteuropa vom Mittelalter bis zu Gegenwart. Es trägt mit seinen Forschungsergebnissen dazu bei, die Beiträge von Juden zur historischen Entwicklung der Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Politik, Recht, Wissenschaft und Kultur, sichtbar zu machen und die Stellung der jüdischen Bevölkerung innerhalb der deutschen Gesellschaft zu reflektieren.
Hintergrund
Die Leibniz-Gemeinschaft umfasst gegenwärtig 91 außerhochschulische Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen. Die Forschungseinrichtungen sind auf Forschungsfeldern tätig, welche eine langfristig angelegte Bearbeitung erfordern, in der Regel interdisziplinär ausgerichtet sind und sich wegen ihres Umfangs, ihrer langfristigen Anlage oder ihrer Inhalte sehr gut außeruniversitär umsetzen lassen. Die Infrastruktureinrichtungen erbringen für die hochschulische und außerhochschulische Forschung wissenschaftliche Informations- und Serviceleistungen. Bund und Länder fördern die Leibniz-Einrichtungen 2017 mit rund 1,2 Milliarden Euro.
VERWEISE
- ...
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen unterstützt nachdrücklich den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD mit seinem klaren Bekenntnis zu einem starken Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland. Die Punkte zu Bildung, Forschung und Innovation sind wichtige Signale …
Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 3.1 Prozent Forschung und Entwicklung in Deutschland im Jahr 2023: Neue Höchstwerte und zentrale Trends Im Jahr 2023 werden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland mit 129,7 Milliarden …
Heute startet der Deutsche Bildungsserver in Kooperation mit dem Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) die neue Podcast-Reihe »Bildungsforschung für die Bildungspraxis«. In der Reihe geht es um Herausforderungen aus dem beruflichen Alltag von pädagogischen …
EFI: »Bei Digitalisierung nachlegen, Klimaschutz effizient machen, zukunftsfähige Beschäftigung in den Blick nehmen« Deutschland steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel, der durch Digitalisierung und Dekarbonisierung vorangetrieben wird. Diese Entwicklungen bieten …

