Faire Erbschaften fördern soziale Gleichheit
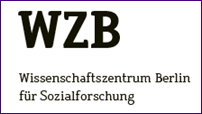
Deutsche Gemeinden, in denen Familien gerecht vererbten, haben bis heute mehr Frauen in Kommunalparlamenten
Soziale Gleichheit ist auch das Ergebnis historischer Erbpraktiken. Deutsche Gemeinden, in denen innerhalb von Familien gerecht vererbt wurde, sind bis heute sozial ausgewogener. Umgekehrt gilt: Wenn Männer oder Erstgeborene das Erbe allein antraten, verstärkt das soziale Ungleichheit. Diese Auswirkungen historischer Erbpraktiken belegt eine WZB-Studie von Anselm Rink.
Konkret hat Rink landwirtschaftliche Erbpraktiken im 19. Jahrhundert untersucht. Diese variierten in Deutschland von Gemeinde zu Gemeinde stark. Somit lässt sich der Zusammenhang von historischen Erbschaften und sozialer Gleichheit auf lokaler Ebene gut untersuchen. Um soziale Gleichheit zu messen, nutzt die Studie den Anteil von Frauen in Kommunalparlamenten und den Anteil von Adligen in Rotary Clubs.
Die Analysen zeigen, dass historische Erbpraktiken nachhaltig soziale Gleichheit geprägt haben. Gemeinden, in denen in der Vergangenheit fair vererbt wurde, sind bis zum heutigen Tage sozial ausgewogener. Dort sitzen mehr Frauen in Kommunalparlamenten, und Mitglieder von Rotary Clubs tragen seltener adlige Namen. Faire Erbschaften unterstützen also historisch benachteiligte Gruppen – wie Frauen –, während sie historisch einflussreiche Gruppen – wie Adlige – eher bremsen.
Die Studie erklärt diesen Zusammenhang mit zwei Mechanismen: Erstens stellen faire Erbsitten sicher, dass Vermögen gleich verteilt wird. Dies erlaubt es insbesondere Frauen, sich stärker gesellschaftlich einzubringen. Zweitens gewöhnen faire Erbsitten Menschen daran, dass Wohlstand zu teilen ist. „Diese Gewohnheit führt vermutlich dazu, dass sich Menschen stärker für Gleichheit einsetzen. Gleichheit wird dadurch zur Norm“, erklärt Anselm Rink.
Hintergrund
Die Studie erscheint in Kürze im American Journal of Political Science. Eine Kurzfassung der Studie finden Sie im aktuellen Heft der „WZB-Mitteilungen: "Das Rätsel der Ungleichheit. Historische Erbsitten haben Auswirkungen bis heute" (siehe Link unten).
Anselm Rink ist Juniorprofessor für Politische Ökonomie an der Universität Konstanz und war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung des WZB.
VERWEISE
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Projekt LINEup stellt erste Fortschritte vor Das von der Europäischen Union geförderte Forschungsprojekt LINEup hat sich zum Ziel gesetzt, Bildungsungleichheiten in Europa zu untersuchen und gerechtere Bildungssysteme zu fördern. Ein kürzlich veröffentlichter Zwischenbericht …
Je höher die Stufe der akademischen Karriere, desto niedriger der Frauenanteil Ende 2023 lag der Frauenanteil unter den rund 51.900 hauptberuflichen Professor*innen in Deutschland bei lediglich 29 %. Laut einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes bedeutet dies zwar …
Wie können kulturelle Bildungsangebote helfen, soziale Ungleichheit ins Bewusstsein zu bringen? Mit dieser Frage befasst sich das Projekt »Exploring and Educating Cultural Literacy through Art« (EXPECT_ART), das von der Europäischen Union im Rahmen des Programms »Horizont …
Vermögen spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse sozialer Ungleichheit. Dennoch hängt der Einfluss des Faktors Vermögen bei den Ergebnissen davon ab, wie man den Zusammenhang modelliert. Eine neue Studie von Forscher*innen des GESIS – Leibniz-Institut für …

